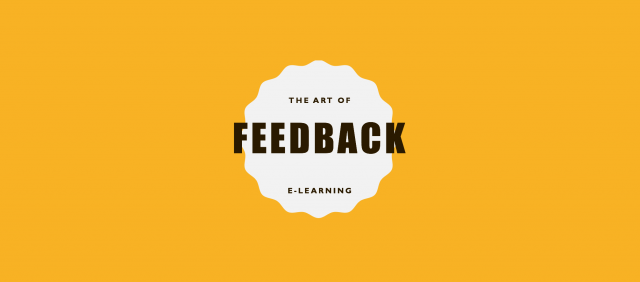Huch, ich habe mir gestern bei Facebook eine schlechte Laune eingefangen!
Vermutlich haben es außer mir schon alle gelesen. Die großen Medien sind mit dem Thema ja auch schon wieder durch. Wovon ich rede?
Es gab da am 17. Juni 2014 eine Veröffentlichung dazu, wie Facebook gezielt die Laune einiger Nutzer (N=689003) versucht hat zu beeinflussen. Die Empörung war und ist groß. Ich bin erst heute dazu gekommen mir die Studie mal genauer anzuschauen, denn das was Journalisten so aus Fakten machen beeinflusst derweilen auch schon mal meine Laune. Also, was ist da wirklich passiert?
Hintergrund: Facebook Studie zur »emotionalen Ansteckung« über soziale Netzwerke
Facebook hat besagte Studie publiziert. Wir können wohl davon ausgehen, dass für das Big-Data-Unternehmen Facebook derlei Analysen daily-business sind. Jetzt werden Ergebnisse halt mal mit der Allgemeinheit geteilt. Finde ich erstmal nicht schlecht.
Die drei Forscher (Adam D. I. Kramer, Jamie E. Guillory und Jeffrey T. Hancock) haben eine Auswahl der englisch sprechenden Nutzer (N=689003) in zwei Versuchsbedingungen und zwei Kontrollgruppen aufgeteilt.
Für Versuchsbedingung 1 wurden emotional negativ gefärbte Beiträge aus dem Newsfeed größtenteils eliminiert. Die Forscher betonen, dass der Newsfeed (die Seite, die jeder anschaut, wenn er/sie sich auf Facebook die Beiträge von Freunden und Bekannten durchliest) aufgrund der sonst zu großen Anzahl neuer Beiträge sowieso gefiltert wird. Dies geschehe im Interesse des Nutzers und mit dem Ziel, dass der verwendete Algorithmus das Nutzererlebnis verbessert. Ich persönlich kann negative Emotionen in Posts meiner Facebook-Freunde mit der Lupe suchen. Vielleicht ist das in anderen Kreisen aber auch ganz anders. Die Forscher geben an, dass 22,4% der Beiträge als »emotional negativ« formuliert eingestuft wurden.
Positiv formulierte Beiträge gab es mehr, nämlich 46,8%. In Versuchsbedingung 2 wurde der Anteil dieser gut gelaunten Beiträge weitestgehend eliminiert. Das verwendete Verfahren für die Einstufung als positiver bzw. negativer Post war relativ schlicht gehalten und basiert auf einer Wortliste und anschließender Zählung durch eine Software. Kein Mensch habe die Beiträge persönlich gelesen, also sei die Vertraulichkeit persönlicher Inhalte gewahrt gewesen.
Für beide Bedingungen gab es dann auch noch jeweils eine Kontrollgruppe, in der der Newsfeed jeweils nicht manipuliert wurde. Pro Bedingung kamen rund 155000 Versuchspersonen zusammen, die mindestens ein persönliches Statusupdate im Untersuchungszeitraum (eine Woche) gepostet haben.
Ergebnisse: Gibt es eine »emotionale Ansteckungsgefahr« via Facebook?
Die Forscher sagen ja. Ohne eine persönliche Interaktion und ohne non-verbale Hinweise (Lächeln, Tränen…) übertragen sich die im Newsfeed von Facebook vorherrschenden Stimmungen auf die eigenen Posts der Versuchspersonen. Wer mit schlechter Laune konfrontiert war, bekommt selbst eine schlechtere Laune. Wer weitgehend glückliche Menschen um sich hatte, verfasst dann auch mehr positiv formulierte Beiträge. Die folgende Grafik ist dem Artikel entnommen und zeigt neben den (statistisch signifikanten) Gruppenunterschieden auch die Standardfehler.

Abbildung aus Kramer et al. (2014): Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks
Im Artikel schreiben die Autoren, dass sie in der einen Woche insgesamt 3 Millionen Posts mit über 122 Millionen Wörtern analysiert haben. Sie fanden darin im Durchschnitt 4 Millionen positive Wörter (3,6%) und 1,8 Millionen negative Wörter (1,6%). Diese Prozentwerte passen nicht zu denen in der Grafik (siehe oben). Allerdings scheinen die Autoren die Prozentwerte für ihre statistischen Tests anders berechnet zu haben, nämlich als Mittelwerte über die Mittelwerte der Versuchspersonen. Evtl. erklärt sich so der Widerspruch.
Wir sehen aber in der Grafik auch, dass die Effekte recht klein sind und nur aufgrund der gigantischen Stichprobenumfänge statistisch signifikant werden. Schauen wir uns das mal für den größten Effekt in der Bedingung mit eliminierten positiven Wörtern und deren Einfluss auf die eigene Verwendung positiver Wörter an. Wer also kaum noch positive Beiträge in seinem Newsfeed sieht, baut selbst im Vergleich zur Kontrollgruppe ca. 0,14% weniger positive Wörter in seine eigenen Posts ein. Der tatsächliche Effekt ist offenkundig wirklich sehr klein und vielleicht nicht besonders relevant.
Fazit
Zunächst ist der beschriebene Ansteckungseffekt sehr interessant. Eine Übertragung emotionaler Zustände ohne persönlichen Kontakt ist überraschend und spannend zugleich. Der Effekt widerspricht aber auch anderen Studien, die Facebook als Quell schlechter Laune sehen, weil die vielen positiven Beiträge bei den Rezipienten Neidgefühle auslösen. Es bedarf also weiterer Forschung, um die differenzierenden Bedingungen genauer zu untersuchen.
Unbedingt sollte man bei der Diskussion der Facebook-Studie die Größe des Effektes im Auge behalten. Wir sehen, dass das schlichte Entfernen von Beiträgen mit positiven/negativen Worten im Inhalt nicht unmittelbar zur Manie/Depression im sozialen Netzwerk führt. So einfach ist es nicht, die Stimmung zu infizieren.
Auf der anderen Seite wird dies wohl nicht die letzte Studie in diese Richtung gewesen sein. Es wird ausgeklügeltere und effektivere Strategien geben, um Einfluss auf die Stimmung anderer zu nehmen. Und bei einem Netzwerk mit wohl über 1,2 Milliarden Nutzern darf man beim Gedanken daran durchaus mal schlechte Laune bekommen…
Das diese Studie den geltenden ethischen Standards der psychologischen Forschung nicht entspricht, darüber müssen wir nicht reden. Wer an einem Experiment in einer manipulierten Untersuchungsbedingung teilnimmt, der muss dies wissen, selbst wenn die genauen Umstände aus methodischen Überlegungen erst im Nachhinein transparent gemacht werden können. Wir lernen: Unternehmen wie Facebook halten sich nicht an diesen Wertekanon.
Es wurde viel darüber diskutiert, welche Macht ein Unternehmen wie Facebook hat. Warum forscht Facebook in diesem Bereich? Will das Unternehmen zukünftig Werbetreibenden nicht nur zielgruppenspezifische Werbeplätze verkaufen, sondern schafft Kaufinteressenten mit aktiv beeinflusster Stimmungslage? Oder was wird zukünftig vor anstehenden Wahlen passieren? Wäre es vielleicht interessant die öffentliche Gesundheit positiv durch Veränderung des Newsfeeds von Facebook zu beeinflussen?
Auf jeden Fall wecken die Ergebnisse sicherlich Begehrlichkeiten. Einer der Forscher ist laut diesem Artikel vom amerikanischen Verteidigungsministerium bezahlt worden, um Möglichkeiten der Ausbreitung von Unruhen in autoritären Regimen zu untersuchen. Das war ja klar…