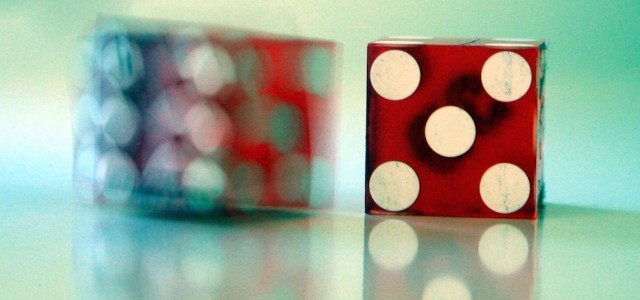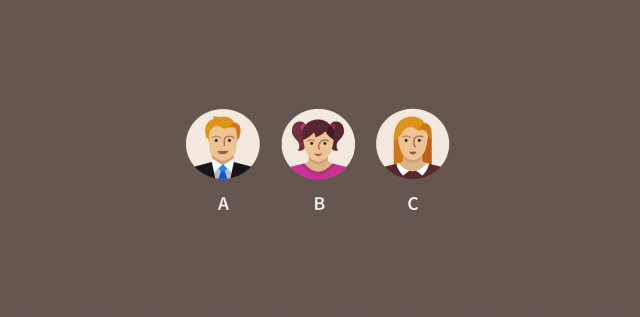Hund im Büro: Warum eigentlich nicht?
Fast 7 Millionen Hunde (Stand 2013) leben mit uns in Deutschland, nur Katzen sind noch verbreiteter (warum auch immer). Da sieht sich der eine oder andere Chef früher oder später mit der Frage eines Mitarbeiters konfrontiert, ob denn Hunde mit an den Arbeitsplatz gebracht werden dürfen.
Für viele Jobs dürfte dies zumindest theoretisch kein Problem darstellen. Praktisch jedoch ist es die große Ausnahme, wenn Bello unterm Schreibtisch liegen darf. Selbst wenn der eine oder andere Vorgesetzte der Idee gegenüber offen eingestellt ist, kommen wahrscheinlich einige der folgenden Gegenargumente:
- Kollege XY hat Angst vor Hunden.
- Kunden haben Angst vor Hunden.
- Der Hund bringt Haare, Dreck und unerwünschte Gerüche ins Büro.
- Der Hund macht Lärm, bellt und lenkt ab.
- Der Hund fordert Aufmerksamkeit und Zeit vom Mitarbeiter, die er dann nicht für die eigene Arbeit aufbringt.
- Mindestens ein Kollege hat eine Allergie gegen Hundehaare.
- Wer haftet, wenn der Hund jemanden beißt?
„Quatsch!“ sage ich. Wenn man wirklich möchte, dann finden sich meist Lösungen, mit denen alle leben können. Viele Argumente sind vorgeschoben und die konstruktive Debatte soll damit schlicht verhindert werden.
In diesem Beitrag wollen wir daher etwas Objektivität der Debatte beimischen und von Studien berichten, die positive (Neben-)Wirkungen der Bürohunde belegen.
Eine interessante Quelle ist der sehr aktuelle Forschungsbericht von Paul E. Olsen vom Saint Michael’s College (November, 2015) sowie auf eine der ersten mir bekannten Studien zum Thema von Wells & Perrine aus dem Jahr 2001.
Positive (Neben-)Wirkungen von Hunden am Arbeitsplatz
Sable (2013) hat den Zusammenhang zwischen Haustieren und Gesundheit und Wohlbefinden untersucht. Er fasst auf Seite 93 seine Forschungsergebnisse wie folgt zusammen: …es gibt überzeugende empirische Evidenz, dass Begleithunde positive Auswirkungen auf die physische und die psychische Gesundheit haben. Sie helfen Menschen, ihre Emotionen besser zu regulieren, mit Stresssituationen umzugehen und Beziehungen zu anderen Aufzubauen. Ich fasse also zusammen:
- Die eigenen Emotionen besser im Griff haben.
- Stress besser ertragen können.
- Leichter mit anderen (Kollegen und Kunden) in Kontakt kommen.
Gilt dies nur für den Besitzer des Hundes? Keinesfalls. Auch Wells und Perrine (2001) kamen in ihrer Fragebogenstudie zu dem Kernergebnis, dass Hunde am Arbeitsplatz zumindest für eine Teil der Gesamtbelegschaft den wahrgenommen Stress im Job erheblich abmilderten.
Headey und Grabka (2011) stellen eine Verbindung zwischen dem Besitz eines Haustiers und der allgemeinen Gesundheit her. Sie finden Evidenz dafür, dass Hundebesitzer insgesamt seltener zum Arzt gehen.
Friedmann, Barker und Allen (2011) vermuten, dass neben der höheren körperlichen Aktivität durch die Spaziergänge an der frischen Luft auch die Reduktion des Stresserlebens in Gegenwart der Tiere die bessere Gesundheit erklären könnte. Tatsächlich argumentieren auch andere Forscher in diese Richtung, was für Unternehmen durchaus die wirtschaftlich relevante Frage aufwirft, wie sich der Krankenstand positiv durch Hunde am Arbeitsplatz verbessern ließe.
Für Unternehmen, die im Wettbewerb um gute Mitarbeiter stehen, ist zudem die Erlaubnis von Hunden am Arbeitsplatz eine sehr kostengünstige Möglichkeit, sich von Mitbewerbern zu unterscheiden und an Arbeitgeberattraktivität zu gewinnen. 65% der Teilnehmer einer Fragebogenstudie vom „Modern Dog Magazine“ erklärten sich bereit auf Gehalt zu verzichten, wenn sie ihren Hund mit zur Arbeit bringen dürften (Evans, 2013). „Hunde sind bei uns willkommen!“ Welches stärkere Signal könnte ein Unternehmen aussenden, wenn es als offen, warm und sozial wahrgenommen werden möchte?
Übrigens, insbesondere bei Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt finden Wells und Perrine (2001), dass die Hunde eine unterhaltende und entspannende Wirkung ausüben. Sie fungieren als Eisbrecher.
Barker, Knisely, Barker, Cobb und Schubert (2012) haben drei Gruppen von Mitarbeitern genauer untersucht und deren Stresslevel, Organisationales Commitment und Arbeitszufriedenheit betrachtet:
- Mitarbeiter, die ihren Hund mit zur Arbeit bringen
- Mitarbeiter, die Ihren Hund nicht mit zur Arbeit bringen.
- Mitarbeiter, die keinen Hund haben.
Die Forscher fanden heraus, dass im Laufe des Arbeitstages der Stresslevel (Blutuntersuchung) bei den Gruppen B+C anstieg und bei der Gruppe A abnimmt. Diese Studie unterstützt somit die oben bereits berichteten Ergebnisse, die auf Selbsteinschätzungen beruhen. Commitment und Zufriedenheit war in Gruppe A ebenfalls erhöht.
Cohen und Davis (2012) untersuchten Anwaltsbüros und kommen zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Sie stellen fest, dass Hunde helfen, die Stimmung zu verbessern und dazu beitragen den Blutdruck zu senken.
Objektive Probleme mit Hunden am Arbeitsplatz
Laut American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI, 2010) leiden tatsächlich rund 10% aller Amerikaner an Haustierallergien. Wir gehen grob davon aus, dass dieser Anteil in Deutschland nicht wesentlich anders ausfällt. Unglücklicherweise sind neben Katzenhaaren tatsächlich auch Hundehaare ein möglicher Auslöser.
Ebenfalls aus den USA stammt eine Studie von Curtis und Kollegen (1998), die ca. 8000 Menschen befragten. Sie ermittelten damals, dass 22,2% der Studienteilnehmer intensive Ängste vor Tieren erleben.
Ein weiterer Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist ein kulturell-religiöser, der mit zunehmender Vielfalt in unserem Land an Bedeutung gewinnt. In einigen Kulturen/Religionen gelten Hunde als unrein.
Letztlich möchte ich auch noch auf die juristische Komponente hinweisen, ohne mich allerdings dazu zu positionieren. In der Tat kann es Hunde geben, die am Arbeitsplatz nur schwer zu ertragen sind. Es scheint mir daher aus Arbeitgeberperspektive durchaus relevant, das Mitbringen von Hunden an bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen. Ein uneingeschränktes „Recht“ auf Hunde im Büro würde ich tatsächlich sehr kritisch sehen. Ein durchsetzbarer Anspruch ist wahrscheinlich eine große Angst vieler Arbeitgeber. Kontaktieren Sie im Zweifel den Juristen Ihres Vertrauens…

Quelle: Kevin Hall photo – Creative Commons Lizenz
Update:
Gestern lief im WDR die Sendung Quarks & Co. Es ging dort um Hunde und es wurden auch einige weitere Studien berichtet. Die Sendung ist in der ARD Mediathek angeblich bis zum 12.01.2021 under diesem Link verfügbar.
Literatur:
American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI). (2010). Pet Allergies Information. Retrieved on March 11, 2014.
Barker, R.T., Knisely, J.S., Barker, S.B., Cobb, R.K., & Schubert, C.M. (2012). Preliminary investigation of employee’s dog presence on stress and organizations perceptions. International Journal of Workplace Health Management, 5 (1): 15.
Cohen, D.L. & Davis, R.F. (2012). It’s a dog’s life at some solo offices. ABA Journal, Nov., Vol. 98, Issue 11, p. 30-31.
Curtis, G. C., W. J. Magee, W. W. Eaton, H. U. Wittchen, and R. C. Kessler. (1998). Specific fears and phobias: Epidemiology and classification. British Journal of Psychiatry, 173, p. 212– 217.
Evans, L. (2013). Will work for biscuits. Canadian Business, Vol. 86, Issue 11/12, p. 72-73.
Friedmann, E.A., Barker, S. B., & Allen, K.M. (2011). Physiological correlates of health benefits from pets. In P. McCardle, S. McCune, J.A. Griffin & V. Maholmes (Eds.), How animals affect us: examining the influence of human-animal interaction on child development and human health (pp. 163-182). Washington DC: American Psychological Association.
Headey, B. & Grabka, M. (2011). Health correlates of pet ownership from national surveys. In P. McCardle, S. McCune, J.A. Griffin & V. Maholmes (Eds.), How animals affect us: examining the influence of human-animal interaction on child development and human health (p. 153-162). Washington DC: American Psychological Association.
Meredith Wells and Rose Perrine (2001). Critters in the cube farm: Perceived psychological and organizational effects of pets in the workplace. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (1), 81-87.
Olsen, Paul E. (2015). See Spot Run? the Dogs in the Workplace Debate. Journal of Case Studies. Vol. 33, No. 2, 116-122.
Sable, P. (2013). The pet connection: an attachment perspective. Clinical Social Work Journal, Vol. 41, Issue 1, p. 93-99.